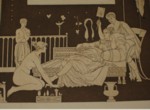[Für Bild-Vergrösserungen und Details aufs Foto klicken]

Abb.1 Fahnenfächer
nach Tizian
(aus Blondel, Bibliog. Nr.85)

Abb.3 Griechisch-römische
Vasenbemalung
Abbildungen 2-4 dieser Seite stammen von P. Avril, aus O. Uzanne, L'éventail
Eros et Amor: Liebes-Symbolik auf Fächern (1)
1.
Einleitung:
Der europäische Fächer wurde von Anfang an nicht nur als nützliches
– Luft fächelndes – Objekt betrachtet, sondern als Schmuckstück
und Statussymbol. Ab der Renaissance (etwa 1400) gehörte der Fächer
in Feder-, Stiel- oder Fahnenform, zum Outfit der aristokratischen Frau
(und gelegentlich auch des Mannes). Seine Rolle bestand hauptsächlich
darin, die Trägerin in ihrer Haltung und in ihren Gesten zu unterstützen
und damit gleichzeitig Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht zufällig
wurden die Fahnenfächer des italienischen Cinque-
und Seicento (16./17. Jhdt.), die ihrer Form nach, wie der Name schon
sagt, Standarten glichen, vor allem von unverheirateten Mädchen,
Bräuten und Kurtisanen getragen. Dazu gibt es die Bilder Tizians
von seiner Tochter Lavinia (Lavinia als Braut, Dresden, Gemäldegalerie),
bzw. Modezeichnungen Vecellios (um 1590). Elizabeth I. von England war
sich bewusst, dass ihr schönster Körperteil ihre Hände
waren, und so liess sie sich Fächer schenken, und trug meist auf
den Gemälden Federfächer, später auch schon Faltfächer.
Das Aufkommen der Faltfächer Ende des 16. Jahrhudnerts
schliesslich leitete den Siegeszug des Fächers ein. Neben der graziösen
Handhabung kam nun ein weiteres Element dazu, das den Fächer über
Jahrhunderte in den Mittelpunkt stellte: der Überraschungseffekt.
Mit einer kleinen Handbewegung ("un instrument qui s'estendoit
et se replioit en y donnant seulement un coup de doigt…", aus "L'isle
des hermaphrodites" 1588, zitiert in Blondel) lässt sich nun
der Fächer öffnen und aus einem vermeintlichen Stab entsteht
eine Miniaturmalerei im Halbkreis. Die so entfaltete Pracht zeigte anfangs
(17. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert) meist gemalte Szenen der antiken
Mythologie, die aber oft nur dem ewig alten und neuen Thema von Eros
und Liebe als Vorwand dienten. Es blieb der Fächerträgerin
überlassen, welche Szene sie ihrer Umgebung zeigen wollte – und
welcher Rückschluss auf ihre Person sich daraus schliessen liess.
2.
Mythologische Szenen:
Ab dem Mittelalter waren Ovids Metamorphosen eine oft gelesene Literatur,
und die griechischen Götter- und Heldensagen waren die einzigen
Quellen der Bildung (neben der Bibel und einigen "Mode-Autoren",
wie Torquato Tassso). Daher ist davon auszugehen, dass sowohl Damen
wie Herren die Sagen, Figuren und deren symbolische Bedeutung kannten.
Die folgenden Szenen kommen häufig auf Gemälden der Renaissance
und des Barocks vor, und dienten ebenso oft Fächermalern als Inspiration:
Zeus und Danae: Der stets durch schöne Frauen verlockte,
seiner Frau Hera (Juno) untreue Göttervater Zeus (Jupiter) vereint
sich mit Danae, indem er als Goldregen auf sie niederfällt. Auf
der einen Seite ist Zeus, der wie meistens mit List eine ehebrecherische
Vereinigung herbeiführt, auf der anderen Seite haben wir Danae,
die als liegender Akt dargestellt wird, aber deren ursprüngliche
Keuschheit auch christlichen Interpretationen offensteht und als Präfiguration
der Verkündigung Marias gedeutet wurde. (S.71, Götter und
Helden der Antike, Bildlexikon der Kunst Band 1, 2003, Berlin).